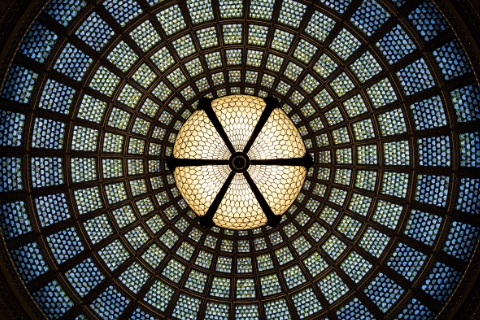An die Leistungsgrenze und zurück
«Demut ist häufig schon zu einer Kraftquelle geworden»
Stefan Keller überlebte einen Autounfall und einen Gleitschirmunfall, überstand seine Firmenliquidation und fuhr mit seinem Handrollstuhl nach Spanien. Seine Grenzerfahrungen haben ihn immer stärker gemacht. Heute gibt er seine Erfahrungen als Coach weiter und unterstützt Menschen bei der Suche nach ihrer eigenen Leistungsgrenze.

Neubeginn als Coach: Stefan Keller
Interview THOMAS OSWALD
Fotos CHANTAL VUILLEMIN und STEFAN KELLER
Wann sind Sie in Ihrem bisherigen Leben an Ihre Leistungsgrenze gekommen?
STEFAN KELLER: Die Leistungsgrenze, denke ich, die haben wir einfach so im Kopf. In unserem Bewusstsein oder wahrscheinlich häufiger im Unterbewusstsein. Klar kam es schon vor, dass ich an dieser Grenze war. Wenn ich da zum Beispiel an eine Tagesetappe auf meiner Reise mit dem Rollstuhl nach Spanien denke, als ich den ganzen Tag gegen den Wind unterwegs war. Dies mit dem halben Tempo als an anderen Tagen. Doch schliesslich doppelt so fixfertig als bei normalen Verhältnissen und als ich am Ende des Tages, nachdem ich nur 40 Kilometer zu rückgelegt hatte, an der Grenze zur Erschöpfung gerade noch so zu einem Pizzawagen gerollt war. Bevor ich die Pizza ass, dachte ich mir: «So, das reicht, ich höre auf.» Doch nach der Pizza war dann wieder klar: Morgen geht es weiter.
Haben Sie diese Grenze sogar überschritten, sodass Sie aufgeben wollten?
Also dass ich an dem Punkt war, wo ich auch das Gefühl hatte, das mache ich nicht mehr, es reicht, das kam eigent lich schon ganz oft vor. Ich machte aber jedes Mal die Erfahrung, dass es irgendwie weitergeht. Also wenn du meinst, jetzt geht es nicht weiter, dann mach weiter.
Sie haben eine bewegte Biografie. Sie sind heute auf den Rollstuhl angewiesen, hatten einen schweren Auto- und Gleitschirmunfall. Kamen Sie da an Grenzen?
Also der Autounfall, das ist schon sehr lange her. Im Rollstuhl bin ich jetzt, weil ich vom Himmel gefallen war. Der Autounfall war im Alter von 21 Jahren, aber er passierte in einer für mich sonst schon bewegten Zeit. Im vierten Lehrjahr wurde ich zum ersten Mal Vater, was auch nicht ganz so einfach war, da wir damals noch nicht volljährig waren. Das war man damals erst mit 20 Jahren, und so hatten wir noch viel mit Behörden zu tun. Dann absolvierte ich die Lehrabschlussprüfung, die Rekruten und Unteroffiziersschule, und während dieser Zeit kam das zweite Kind zur Welt. Während der Unteroffiziersschule musste ich auch noch einen Leistenbruch operieren las sen. Dabei kam es zu einem Narkosezwischenfall. Wegen dieses Zwischenfalls und dessen Folgen wurde ich gegen meinen Willen in eine geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik eingewiesen. Als ich das endlich überstanden hatte, hatte ich kurz darauf den Autounfall. Nebst einem kaputten Becken hatte ich auch zahlreiche innere Verletzungen. Ja, das war die Folge von ganz vielen schwierigen Dingen und Geschichten in einem Alter, in dem ich ja wirklich noch jung war und mit den Gegebenheiten noch nicht so gut umgehen konnte.
Ich fragte mich dann einerseits schon: Wieso passieren solche Sachen immer mir? Andererseits genoss ich auch einfach die Ruhe im Spitalbett. Sicher, ich ging in dieser Zeit in vielerlei Hinsichten über Grenzen hinaus.

Wir haben Ihren schweren Gleitschirmunfall angesprochen. Wie war es für Sie, als Sie bemerkten, dass Sie Ihre Beine nicht mehr spürten?
Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ich erinnere mich an den Start, das Abheben, die ersten paar Meter und an die Störung am Schirm. Dann setzten die Erinnerungen erst wieder im Aufwachraum des Inselspitals ein. Ich sehe mich noch zwischen diesen gelben Vorhängen, wie in einem Zelt aus einem Monumentalfilm. Dann kam zwischen diesen Tüchern der Arzt, der die Notoperation durch geführt hatte, auf mich zu und sagte, ich hätte Glück gehabt. Ich habe ihn nur so angeschaut und dachte, ja, wenn das nicht der Petrus ist, dann hatte ich wirklich Glück. Der Arzt sagte mir auch gleich, dass ich wieder ein wenig laufen könne. Aber ein paar andere Dinge würden nicht mehr so wie früher funktionieren. Damals wusste ich noch nicht, was damit gemeint war. «Wieder ein wenig laufen können» konnte ich noch nicht richtig einordnen. Denn ein wenig laufen ist ja nicht gleich laufen. Heute kann ich sagen, es ist nützlich, aufstehen zu können und ein paar Schritte zu gehen. Doch meine Beine sind nicht mehr das Fortbewegungsmittel, das sie mal waren.
In den ersten Telefonaten nach der Operation, als meine Leute wissen wollten, wie es aussehe, erklärte ich, es komme alles wieder gut. Zum Starten und Landen sollte es zumindest reichen. Diese Einschätzung hat sich bewahrheitet. Für mich war es Glück und wichtig zu wissen, dass das Leben auch im Rollstuhl weitergeht. Das hat damit zu tun, dass ich schon vor meinem Unfall Rollstuhlfahrern das Gleitschirmfliegen beigebracht hatte.
Sie haben gehbehinderten Menschen das Gleitschirmfliegen beigebracht. Nach Ihrem Unfall gaben Sie Ihre Schule allerdings auf. Aus welchen Gründen?
Der Unfall geschah 2013. Vor dem Unfall hatte ich eine Flugschule für Fussgänger und Rollstuhlfahrer, und nach dem Unfall hatte ich eine Flugschule für Rollstuhlfahrer und Fussgänger. Ich setzte die Prioritäten anders. Das Verhältnis an Schülern war zwar mehr oder weniger dasselbe, aber ich hatte nach dem Unfall einen anderen Typ von Schülern. Das war für mich ein spannender Effekt. Ich betrieb die Schule auch noch vier Jahre. Jedoch spürte ich, dass ich körperlich an meine Grenzen komme und dass ich die Flugschule so sicher nicht bis 65 oder gar ein wenig darüber hinaus betreiben kann. Darum sagte ich mir, nun sei es Zeit, ein paar Dinge zu verändern, damit ich doch noch länger erwerbstätig sein könne
Sie haben gesagt, nach dem Unfall hatten Sie einen anderen Schülertyp. Was genau war denn anders?
Gleitschirmfliegen heisst, man setzt sich der Schwerkraft aus. Und wenn sich der Mensch der Schwerkraft aussetzt, kann der Mensch auch vom Himmel fallen, und dieser Eventualität muss man sich stellen können. Das aber können viele Gleitschirmflieger leider nicht. Wenn ich mit dem Rollstuhl fliege, polarisiert das natürlich. Jene, welche die Gefahr verdrängen, kommen nicht mehr, und jene angehenden Piloten, die sich der Eventualität stellen, kommen erst recht, weil sie sich direkt damit auseinander setzen können. Ich bin auch der Überzeugung, dass das sicherheitsrelevant ist.
Dinge, die verdrängt werden, können zu einer Gefahr werden. Doch wenn man sich diesem Umstand stellt und alles unternimmt, um den Sport möglichst sicher zu betreiben, ist das der bessere Umgang. So kann ich sagen, nach dem Unfall hatte ich mehr solche Schüler, und das waren auch die angenehmeren.
Stefan Keller, Coach
Man könnte nun sagen, Sie haben als Lehrer bildlich auf die mögliche Gefahr hingewiesen und vielleicht auch beim einen oder anderen vermeintliche Leistungsgrenzen aufgezeigt?
Fliegen mit dem Rollstuhl polarisiert. Die einen wollen nicht wahrhaben, dass so etwas passieren kann. Andererseits bin ich 2015 an den Schweizer Meisterschaften mit geflogen, ohne logischerweise eine Chance auf einen guten Platz zu haben. Ich bin aber im Startpulk vor dem sogenannten Luftstart, wo sich alle positionieren, um dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, auf die Strecke zu gehen, mitgeflogen. Nach dem Rennen kam dann doch der eine oder andere Pilot zu mir, um mir mitzuteilen, es würde richtig guttun zu sehen, dass ich da im Startpulk mitfliegen könne. Damit zeigte ich sehr eindrücklich, selbst im Wettkampfmodus, bei dem mehr Risiko eingegangen wird, dass, wenn tatsächlich ein Unfall passieren würde, das Leben weitergehe. Das zu wissen, sei befrei end, und wenn man frei fliegen könne, erlaube das auch, das Risiko besser einzuschätzen, was wiederum das Unfallrisiko reduziere und somit eher befreiend als belastend wirke.
Die zwei Unfälle und die folgenden Einschränkungen seien aber nicht Ihre grösste Herausforderung im Leben gewesen. Hat Sie die Liquidation Ihrer ersten Firma an die Leistungsgrenze oder gar darüber hinaus gebracht?
Das hat mich sicher gefordert. Nur, wo sind die Grenzen? Ich habe die Grenzen nicht überschritten, denn am Schluss kam alles gut. Also habe ich mich innerhalb der Grenzen bewegt. Wie nahe an der Grenze, weiss ich natürlich nicht. Jedenfalls war dies eine Challenge. Auch dort gab es Situationen, in denen ich oft nicht wusste, wie das jetzt weitergehe, ob ich das schaffe und wie ich das auf die Reihe bringe. Als es am schwierigsten war, ging ich fliegen. Das hat mir geholfen, aus der Vogel- oder Helikopterperspektive Distanz zu den Problemen und Dingen, die abgewickelt werden mussten, zu bekommen. Dieses Vor gehen war auch hilfreich, die Distanz zu mir zu finden. Immer wenn ich den Boden verlassen hatte, nahm ich eine andere Perspektive, eine andere Position ein. Physisch, jedoch auch zu mir selbst. Immer wenn man sich in die Luft begibt, ist das auch ein gewisser Akt von Demut. Mit dem Wissen, dass man zwar alles gut machen kann, umsichtig ist und für die Sicherheit sorgt. Aber auch mit dem Bewusstsein, dass man ein bisschen Glück braucht und dass nicht alles nur einfach in den eigenen Händen liegt. Dass wir Menschen sicher nicht das Höchste sind. Diese Demut ist häufig schon zu einer Kraftquelle geworden.
Sie sagten selbst, der Mensch sollte sich nicht zu ernst nehmen, sich auch mal distanzieren und sich selbst hinterfragen. Ist dies in der heutigen Zeit, wo es um immer mehr Leistung geht, noch möglich, oder ist genau das eine Möglichkeit, seine Grenzen zu verschieben?
Auf der einen Seite ist wichtig, dass man sich seines eigenen Werts bewusst ist. Selbstbewusstsein und Selbstwert haben sehr viel mit sich selbst ernst nehmen zu tun. Gleichwohl sollte man sich nicht überbewerten und auf einen allzu hohen Thron stellen und sich zu wichtig nehmen. So wichtig sind wir eigentlich auch nicht. Wir leben bei uns in der Schweiz statistisch gesehen 32000 Tage, und gemessen am Alter unseres Planeten ist das nichts.
 «Wenn man sich in die Luft begibt, ist das auch ein gewisser Akt von Demut.»
«Wenn man sich in die Luft begibt, ist das auch ein gewisser Akt von Demut.»Stefan Keller, Coach
Sie waren vor wenigen Jahren ausgebrannt. Was war der Grund, und wie haben Sie die Zeit überwunden?
Das war, nachdem ich vor fünf Jahren meine Flugschule übergeben hatte. Wenn man eine Flugschule hat, orien tiert man sich zu einem sehr grossen Teil am Wetter. Das Wetter bestimmt den Alltag. Bei schönem Wetter, also Flugwetter, geht man mit den Schülern und Passagieren fliegen. Bei Regen erledigte ich administrative oder ande re Arbeiten. Darum war es dazumal auch schwierig, mit mir einen privaten Termin zu vereinbaren, denn es hätte ja Flugwetter sein können. Das hat auch dazu geführt, dass sich alle meine sozialen Kontakte im Bereich des Flie gens abgespielt haben. So musste ich mich, nachdem ich die Flugschule einem jüngeren Fluglehrer übergeben hat te, quasi neu erfinden. Dazu kam, dass ich meine Schulter gleich zweimal operieren lassen musste, was mir zu fünf Monaten Ruhe verhalf. Obwohl ich zuvor bei schönem Wetter ständig in der Natur war, ging ich zu dieser Zeit kaum vor die Türe des ParaplegikerZentrums. Danach musste ich mich beruflich neu orientieren und gleiste zuerst neue Projekte auf. Dadurch ergaben sich zwar auch neue soziale Kontakte, aber die Zeit war sehr anstrengend. Da spürte ich, wie ausgebrannt ich war, und ich benötigte Ruhe und Entspannung.
Ihnen wurde also erst mit der durch den Gleitschirmunfall verbundenen Zwangsruhe bewusst, dass Ihnen Ruhe und Entspannung gefehlt haben?
Mit der Flugschule war ich in irgendeiner Form stets sieben Tage die Woche aktiv. Klar hatte ich auch da Entspannungsphasen, und es ist auch kein Dauerstress, aber halt doch eine Daueranspannung und Daueraufmerksamkeit.
Ich war in dieser Zeit während etwa sechs bis acht Wochen pro Jahr mit Gleitschirmschülern und -piloten auf Reisen. Das ist eine total schöne Arbeit mit den schönsten Arbeitsplätzen, zum Beispiel in Italien oder England, wo auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz kommt. Gleichwohl hatte ich die organisatorische Verantwortung. Da geht es nicht nur darum, Flugrouten zu planen, sondern auch zu schauen, dass die Gruppendynamik passt und die Teilnehmer zufrieden sind. Durch das stete Eingespannt- und AufmerksamSein ist das Schöne dann halt doch eine Belastung. Erst wenn diese wegfällt, löst das etwas, und ich merkte, dass ich Erholung brauchte.
Sprechen wir über Leistungsgrenzen. Kann diese Grenze real gemessen werden, oder ist das eine rein persönliche Definition?
Ich denke, das ist zu einem sehr grossen Teil eine persönliche Definition. Denn wenn wir von Leistungsgrenzen reden, wissen wir nie so genau, wo die denn überhaupt sind. Darum scheint mir wichtig, die Grenzen auszuloten, jedoch sie auch dort, wo sie sich zeigen, zu respektieren. Von mir kann ich sagen, dass ich glaube, nicht zu den Menschen zu gehören, die über die Grenzen hinaus gehen. Ich nehme diese sehr gut wahr und reagiere auch darauf, wenn vielleicht auch nicht unmittelbar. Andererseits kann man die Leistungsgrenze auch kleiner machen, als sie ist.
Haben Sie ein Beispiel?
Wenn ich sage, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht, habe ich die Leistungsgrenze bereits erreicht, bevor ich überhaupt etwas gemacht habe. Wenn ich hingegen die Leistungsgrenze überschreite, aber die Zeichen nicht akzeptiere, erleide ich einen Zusammenbruch. Beides hat mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Darum ist eine Definition der Leistungsgrenze, die sich so ergibt, grundsätzlich auch schwammig. Was ist Leistung, was ist Arbeit, und was ist Erfolg? Das hängt alles zusammen, und was dabei herauskommt, ist grösstenteils eine Kopfsache. Also ich meine das, was im Kopf gespeichert ist. Bewusst oder vielmehr unbewusst.
Reichen der Wille und positives Denken, um an seine Leistungsgrenze zu kommen?
Nein, das reicht definitiv nicht. Der Mensch hat verschiedene Schichten seines Bewusstseins. Davon ist ein kleiner Teil das Bewusstsein, in dem auch das positive Denken stattfindet. Der viel grössere Teil allerdings liegt in unserem Unterbewusstsein. Wenn ich nun tief in mir verankert habe, mir keinen Erfolg zu gönnen, nützt auch positives Denken nichts. Ich kann zum Beispiel genauso viel trainieren wie eine stets erfolgreiche Person, erbringe für meine Verhältnisse sogar die grössere Leistung, scheitere schlussendlich aber an meinem Unterbewusstsein.
Abschliessend kann man sagen, Leistung heisst Arbeit multipliziert mit der Zeiteinheit. Das macht jedoch keine Aussage betreffend Ergebnis oder Erfolg. Möglicherweise erbringt der ewige Zweite mehr Leistung als der Seriensieger. Da müsste man sich fragen: Wie viel von der erbrachten Leistung ist Blindleistung? Der SuperGAU wäre, wenn ein Burnout eintritt und ich feststellen muss: Ich habe über eine sehr lange Zeit viel Blindleistung produziert und mich damit stets über meiner Leistungsgrenze bewegt. Im Übrigen haben viele Menschen die Meinung, das Gegenteil von Erfolg sei der Misserfolg. Doch dem ist nicht so. Bei einem Misserfolg habe ich etwas versucht und kann analysieren, warum der Erfolg ausgeblieben ist. Doch wenn ich nichts mache, kann auch nichts erfolgen.