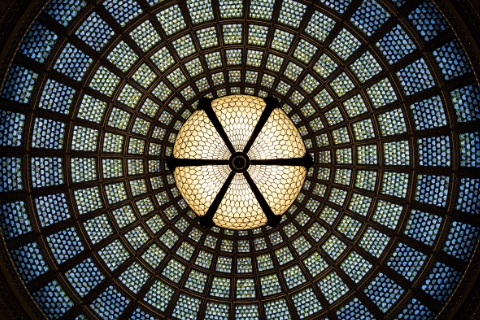Emilia Roig: «Why we matter»
Bunte Herkunft – alltägliche Diskriminierung
Seit zehn Jahren beschäftigt sich die französische Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Emilia Roig mit Diskriminierung und Ausgrenzung. In ihrem Buch «Why we matter» analysiert sie Gründe der gesellschaftlichen Unterdrückung und beschreibt Wege zu ihrer Überwindung.

Emilia Roig lebt ihre bunte Vielfalt.
Text STEFFEN WEISBROD
Durch #MeToo und #BlackLivesMatter ist das Bewusstsein für die Brisanz von Rassismus, Ausgrenzung von Minderheiten und Unterdrückung von Frauen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Buchautorin Emilia Roig ist sowohl persönlich betroffen als auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt. Im kürzlich auf Deutsch erschienenen Buch «Why we matter» verarbeitet die 38-Jährige eigene Erfahrungen und beschreibt mit Theorien und Diskursen, wie gesellschaftliche Hierarchien und Mechanismen der Unterdrückung funktionieren. Anschliessend entwickelt sie Utopien einer Welt, in der der Wert eines Menschen nicht von Geschlecht oder äusserer Erscheinung abhängig gemacht wird.
Rassismus in der Familie
«Ich bin ein Produkt des französischen Kolonialismus. Meine Mutter ist in Martinique geboren, einer der letzten und ewigen französischen Kolonien in der Karibik, politisch korrekt als Übersee-Départements bezeichnet», so beginnt Emilia Roig das Kapitel über ihre Familie. In der Tat liesse sich selbst mit einer blühenden Fantasie kaum ein familiärer Hintergrund konstruieren, der noch diverser und noch bunter wäre als der ihre. Die europäischen, jüdischen, arabischen, indischen, afrikanischen und indigenen Vorfahren, ihre Homosexualität und ihr Bekenntnis zum Feminismus machen sie zur Projektionsfläche für offenen und versteckten Rassismus.
Nach ihrer eigenen Erfahrung seien multiethnische Paare nicht etwa ein Beweis für progressives Denken, sondern im Gegenteil besonders anfällig für rassistische und patriarchische Muster. In ihrem Buch beschreibt sie ihren Grossvater väterlicherseits als liebevollen Opa, der aber zeit seines Lebens bekennender Rassist und aktives Mitglied des rechtsextremen Front national war. Weil er seine Enkelkinder liebte, blendete er aus, dass sie eine dunklere Hautfarbe haben. Ihm fehlte die Empathie, zu begreifen, dass er mit seinen herabwürdigenden Bemerkungen über nichtweisse Menschen seine Schwiegertochter und seine Enkelinnen verletzen könnte. Auch von ihrem Vater ist sie enttäuscht, weil er nie die Äusserungen seiner Eltern als rassistisch verurteilt, sondern sie stattdessen in Schutz genommen habe.
Empathielücke
«Wer zur dominanten Gruppe einer Gesellschaft gehört, lernt nicht, Empathie für jene zu entwickeln, die nicht der Norm angehören …» Mit diesen Worten skizziert Roig die gesellschaftliche Problematik bewusster und unbewusster Ausgrenzung. Die fehlende Fähigkeit oder Bereitschaft, sich in die Perspektive der anderen hineinzuversetzen, bezeichnet sie als «Empathielücke». Die gesellschaftlich dominanten Gruppen definieren ihr zufolge dabei, was als normal gilt. Und diese Gruppen bestünden überwiegend aus «weissen Heteromännern».
In ihrer Argumentationskette beginnt alles damit, dass die Gesellschaft die Sicht der dominanten Gruppen als neutral und objektiv anerkenne. Aus dieser Perspektive entstehen dann die sozialen Hierarchien, bei der zum Beispiel Weisse höher als Schwarze und Frauen niedriger als Männer eingestuft sind. Und Gruppen, die nicht der «Norm» entsprechen, wie Lesben, Schwule, Queere oder Behinderte, stehen weit unten auf der sozialen Hierarchie.
Angehörige der Mehrheit haben es nicht nötig, sich in die Lage der Minderheit zu versetzen. Und umgekehrt nehme die Minderheit unbewusst die Sichtweise der Mehrheit ein. Wie es sich anfühlt, zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören, lernte Roig erst, als sie als Kind einen längeren Zeitraum auf Martinique bei ihren Grosseltern verbrachte. Andererseits wurde ihr dadurch später klar, wie stark ihre Eltern ihre kulturellen Wurzeln verleugnen und sich verbiegen mussten, um in der kolonialen Welt ihrer Jugend eine Aufstiegsperspektive zu haben.
Die Mär von der Meritokratie
Mit fünfzehn Jahren musste Roig erleben, dass Stereotype und Vorurteile stärker sein können als objektive schulische Leistungen: Die Schulleitung stellte für sie keine Gymnasialempfehlung aus, sondern empfahl ihr die Ausbildung zur Friseurin. Erst nach der massiven Intervention ihrer Mutter bekam sie doch noch die «recommandation d’études secondaires». Später wird ihr ein geplanter Quereinstieg in das Fach Jura verwehrt, der «weissen» Studierenden im Vorgängerjahrgang offengestanden war.
Emilia Roig hat schliesslich Business Administration in Lyon und Public Policy in Berlin studiert und in Politikwissenschaften promoviert. Trotzdem will sie ihren akademischen Leistungsausweis nicht als Erfolgsgeschichte gelten lassen, weil ihrer Ansicht nach niemand davon Aufheben machen würde, wenn sie eine helle Hautfarbe hätte.
Im Laufe ihrer Forschungsarbeit stösst sie auf viele Fälle von institutioneller Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte und merkt, dass ihre Erfahrungen keine Einzelfälle waren. Vertreter der Mehrheitsgesellschaft können häufig nicht nachvollziehen, dass ihnen aufgrund von Geschlecht oder äusserer Erscheinung Privilegien zugestanden werden, die Minderheiten vorenthalten bleiben. Roig vergleicht Privilegien mit Jokern beim Kartenspiel: «Wir bekommen alle die gleichen Karten, und manche von uns bekommen von vornherein eine unbegrenzte Anzahl von Jokern, einfach so.»
Die Welt neu gestalten
«Why we matter» ist eine anstrengende Lektüre. Das liegt zum einen an der Fülle an Beispielen und der Dichte an wissenschaftlichen Nachweisen. Es liegt aber sicher auch am Sendungsbewusstsein der Autorin. Trotz der beschränkten Seitenzahl eines Sachbuchs baut sie eine Argumentationskette auf, die quasi alle Ungerechtigkeiten dieser Welt auf ein kulturelles und politisches System der Unterdrückung zurückführt.
Hinzu kommt, dass die Autorin stark aus der feministischen Perspektive argumentiert und in ihrem Buch nicht mit Gendersternchen spart. Im Verlauf ihres Essays entwickelt sie Visionen für eine gerechtere Welt ohne Hierarchien und wagt sich an Gedankenspiele, wie eine postkapitalistische Gesellschaft ohne Polizei, ohne Gefängnisse und ohne abhängige Lohnarbeit funktionieren könnte. Im letzten Abschnitt des Buchs räumt sie ein, dass sie mit der Vermengung von persönlichen Erfahrungen und Gefühlen mit wissenschaftlichen Quellen gegen akademische Publikationsstandards verstossen haben könnte. Aber gerade das macht das Buch so lesenswert.