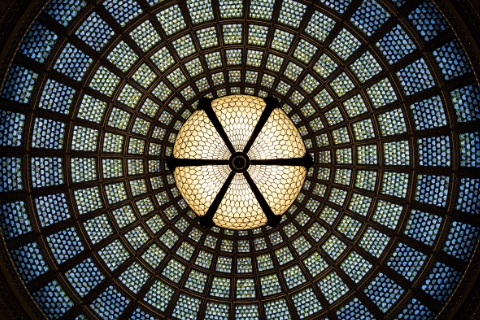Besuch beim Imker
Auf die Biene gekommen
Stefan Stauber und Esther Bärtschi produzieren in der Freizeit Wiediker Honig. Ihre Bienen holen sich Nektar und Pollen in den biologisch bewirtschafteten Kleingärten, Bauernhöfen und Wiesen am Fuss des Zürcher Üetlibergs.

Der Zürcher Hobby-Imker Stefan Stauber und eines seiner zehn Bienenvölker.
Text SULEIKA BAUMGARTNER
Fotos ESTHER BÄRTSCHI
Von wegen Wonnemonat Mai! An diesem Montagnachmittag liegt die Temperatur knapp über 10 Grad, am frühen Morgen waren es im Zürcher Stadtquartier Wiedikon noch 3 Grad – wahrlich kein bienenfreundliches Wetter. «In der Regel fliegen die Bienen bei etwa 10 Grad», sagt der 36-jährige Stefan Stauber. Will heissen: Eigentlich sind die Bienen in den Monaten April und Mai am fleissigsten und damit auch die Imker. Doch wegen des Regens und der tiefen Temperaturen konnte der Hobby-Imker in den letzten Wochen wenige Arbeiten auf dem von der Stadt gepachteten Grundstück am Fusse des Üetlibergs verrichten.
Auf die Biene kamen die Honigbrötchenliebhaber Stefan Stauber und Esther Bärtschi, als sich 2017 Nachwuchs ankündigte. Waren sie vorher gerne und oft mit dem Velo unterwegs, suchten sie nun eine Freizeitbeschäftigung, die sich gut mit den Elternpflichten vereinbaren lässt. Ingenieur Stauber findet bei der Arbeit im Wald seinen Ausgleich, und Biologin und Vogelspezialistin Bärtschi konnte mit dem Aufstellen von Nisthilfen gleich noch etwas für ihre Lieblinge tun.
Bereits 2018 begann der Familienvater, einen Teil der Bienenvölker in offene Magazine im Freien umzusiedeln. Der Vorteil für den Imker: Er arbeitet an der frischen Luft, und der Zugang zu den Brutwaben ist für ihn weniger umständlich, weil er von oben statt von hinten an die Bienenbehausung herankommt. Der Fachausdruck für eine Bienenbehausung lautet übrigens Beute (für weitere fachspezifische Ausdrücke siehe Glossar am Ende des Textes).
Bienenflüsterer und Handwerker
Stauber räumt gleich zu Beginn des Besuchs im Bienenhaus mit falschen Vorstellungen auf: «Manche Leute glauben, imkern bedeute, die ganze Zeit bei den Tieren zu sein. Doch so ist das nicht. Vieles ist Vorbereitungsarbeit, etwa das Reinigen der gebrauchten Geräte. Oder ich schmelze die alten, schon stark bebrüteten Waben mit heissem Dampf ein. Das daraus resultierende flüssige Wachs lässt sich auf diese Weise säubern.» So erstaunt es nicht, dass sowohl der Estrich der Stauber’schen Mietwohnung als auch das Bienenhaus eigentliche Materiallager sind. Stauber benutzt den Begriff Bienenhaus für das Gebäude, in dem sich die konventionellen Behausungen der Bienen, die traditionellen Schweizerkästen, befinden.
Im Bienenhaus am Üetliberg befinden sich die klassischen Schweizerkästen, im Freien die Magazine.

Die Arbeit des Imkers
Der Mensch ist ein Dieb, so viel ist klar. Er stiehlt den Bienen ihren Wintervorrat. Als Ersatz erhalten die Bienen vom Imker gleich nach der letzten Honigernte selbst hergestelltes Zuckerwasser, sonst würden sie glatt verhungern.
«Waldhonig mit einem hohen Anteil an Mineralstoffen kann den Darm der Bienen belasten. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn es im Winter lange kalt ist und sie nicht ausfliegen können», erklärt Stauber. So gesehen könne das Zuckerwasser für die Bienen sogar vorteilhafter sein.
Nun ist er hier, um sich die Grösse der einzelnen Bienenvölker anzuschauen und um zu überprüfen, ob sie noch genug Futter haben. Den Weg von seiner Wohnung zum Bienenhaus hat er mit dem Fahrrad zurückgelegt und wie meistens auch noch Material damit transportiert. «Meine Frau und ich sind da etwas speziell», sagt Stauber, «wir versuchen möglichst alles ohne Auto zu machen, schliesslich stellen wir ein Naturprodukt her.»
Bevor die Schutzbekleidung zur Sprache kommt, weist der Imker auf die Gerätschaften hin, die ihm zur Abwehr zur Verfügung stehen. Das ist einerseits der Smoker, ein Rauch erzeugendes Gerät, anderseits der Wasserzerstäuber. Rauch simuliert Gefahr durch Feuer, Wasser macht die Bienen schwer und sie fliegen dann kaum – zumindest in der Theorie, wie sich später zeigen wird. In beiden Fällen geht es darum, für eine Weile an einem unruhigen, stechlustigen Volk arbeiten zu können. An diesem Tag kommt allerdings nur der Wasserzerstäuber zum Einsatz.
Die freistehenden Magazine hinter dem Bienenhaus. Sie sehen aus wie Holzkisten, die aufeinandergestapelt sind. Der Imker hebt als Erstes den Aluminiumdeckel, der als Wetterschutz dient, vom Magazin. «Mal schauen, wie es aussieht», sagt er. Honig werde es wohl noch keinen haben. Er greift nach dem Stockmeissel und zieht eine der Waben heraus. Diese sogenannte Brutwabe ist zur Hälfte mit Bienen bedeckt, die sich langsam bewegen. Stauber warnt: «Jetzt sind die Bienen schon etwas nervöser. Sie riechen das CO2, das wir mit der Atmung ausstossen. Das ist auch der Grund, weshalb sie eher aufs Gesicht fliegen. Auch beim Bären, ihrem natürlichen Feind, ist das die Schwachstelle.» Und dann: «Oha, da fährt eine Biene ihren Stachel aus. Offenbar sind sie nicht gut gelaunt. Kein Wunder. Wenn es so kühl ist, mögen sie es gar nicht, wenn ich sie störe. Kann ich gut verstehen.» Und dann stellt der Imker fest: «Die haben wahnsinnig viel Brut.» Er zeigt auf die verdeckelte Fläche. «In zehn Tagen werden hier doppelt so viele Bienen leben.» Im Sommer könne ein Volk auch schon mal aus 50 000 Bienen bestehen.
Imker Stefan Stauber zieht die Brutwaben aus dem Magazin und überprüft den Zustand der Bienenvölker.

Eine Biene sticht nur einmal
Stauber untersucht nacheinander die verschiedenen Magazine. Er erklärt, dass jedes Bienenvolk einen anderen Charakter habe: «Das erste Volk, das ich mir anschaute, war lammfromm. Die hier sind deutlich aggressiver.» Und wieder betätigt er den Wasserzerstäuber. Doch zu spät. In diesem Augenblick spürt die Schreibende im linken Oberschenkel einen stechenden Schmerz, der gleich wieder vergeht. War es doch kein Stich? Doch eine Minute später brennt es heftig nach. Es war also keine gute Idee, keinen Ganzkörperoverall anzuziehen.
Später wird ihr der Imker den Unterschied zwischen einem Bienen- und einem Wespenstich erklären und auch, dass nicht alle Bienenstiche gleich schmerzhaft sind: «Es kommt darauf an, wie alt die Bienen sind. Am Anfang ihrer Flugfähigkeit ist die Giftdrüse gut gefüllt, dann tut es am meisten weh. Wenn sie ganz alt sind, schmerzt es weniger, ebenso, wenn der Stich von einer ganz jungen Biene stammt.» Vielleicht war das der Grund, weshalb der zweite Stich, diesmal im rechten Oberschenkel, schliesslich deutlich weniger schmerzte.
Irgendwie schafft es eine Biene auch noch, sich im Gesichtsschleier zu verfangen. Das Summen wird immer lauter, hört sich auf einmal bedrohlich an und gefährlich nahe am Hals. Doch Rettung kommt, der Imker holt die Biene heraus und sagt mit ruhiger Stimme: «Ich kann sehen, dass der Stachel nicht mehr drin ist. Das heisst, diese Biene hat schon einmal zugestochen und kann es beim Menschen nicht ein zweites Mal tun.» Oder anders ausgedrückt: Dieses Insekt bezahlt seine Verteidigung in jedem Fall mit dem Leben – im Gegensatz zu den Wespen, die mehrmals zustechen können und ihren Stachel auch behalten.
Der Honigmacher «liest das Volk» anhand der Brutwabe.

Arbeiten im Sommer
Später im Monat Mai wird Stauber dann das tun, was üblicherweise bereits im April ansteht: Er setzt einen Honigraum auf. Dort wird später von den Bienen der Honig eingelagert.
Danach werden Jungvölker gebildet. Stauber erzählt, wie das geht: «Aus einem Volk nehme ich einen Teil der Bienen heraus, dazu einen Teil der Waben mit Brut darauf. Es muss eine ganz junge Brut sein, denn nur die wird eine neue Königin hervorbringen. Die andere Hälfte des Volkes behält seine Königin.» Wenn die Bienen des ersten Volkes merken, dass sie keine Königin mehr haben, werden sie einen Teil der kleinen Maden so stark füttern, dass statt vieler Arbeiterinnen eine Königin heranwächst.
Durch das Teilen der Völker, so Stauber, muss er keine Bienen dazukaufen. Durch den Verzicht auf den Import von Bienen sinkt zudem die Gefahr, dass Schädlinge eingeschleppt werden. Ein solcher Schädling ist die Varroamilbe. «Die haben wir jetzt überall.»
Und so ist die Bekämpfung dieses Parasiten eine zeitaufwendige Arbeit, die mehrmals pro Jahr im Mittelpunkt steht. Das erste Mal gleich nach der letzten Honigernte Ende Juli oder Anfang August. Das zweite Mal im September und ein drittes Mal im Dezember. Stauber verwendet dafür Ameisensäure, die mittels eines Langzeitverdunsters die Milben und bereits vorhandene Nachkommen in den Zellen vernichtet. Beide seien auch in der biologischen Imkerei zugelassen, denn: «Die Wirkung ist eine rein physikalische.»
Manchmal gibt es im Juni bereits eine erste Honigernte. 2019, so befürchtet Stauber, werde das auf seinem Areal kaum der Fall sein. Seine Kundinnen und Kunden werden demnach auf den hellen Blütenhonig verzichten müssen. Spätestens im Sommer sollte es aber auch im Üetlibergwald Honig geben. Um diesen zu gewinnen, holt der Imker die Waben, die mit reifem Honig gefüllt sind, aus dem Volk raus. Die Bienen schüttelt er von den Waben oder fegt sie mit dem Bienenbesen ab. Danach gibt er die Bienen in die Beute zurück, die noch voller Brutwaben ist. «Das ist der Moment, in dem einige Bienen auffliegen und versuchen werden, mich zu attackieren.»
Die Bienenwachsschicht, mit der die Tiere die einzelnen Zellen luftdicht verschlossen haben, entfernt der Imker und macht sich ans Ausschleudern «Eine Honigschleuder funktioniert ähnlich wie eine Wäscheschleuder. Statt der Wäsche werden die Honigwaben rumgeschleudert. Dadurch läuft der Honig aus. Das Prinzip ist dasselbe: Da wirkt die Zentrifugalkraft.»
Weil die verbrüteten Waben mit der Zeit unansehnlich werden, gibt Stauber immer wieder neue Waben hinzu «So haben die Bienen immer ein schönes Daheim.» Das Herstellen neuer Waben beziehungsweise von Mittelwänden ist eine Arbeit für den Winter. Ebenso wie die Wachsverarbeitung.
Ein Teil der Zellen in dieser Wabe ist bereits verdeckelt. Die Bienen verschliessen sie luftdicht mit Wachs.

Wachskreislauf im Wohnzimmer
Eine Spezialität von Stefan Stauber und Imkerassistentin Esther Bärtschi ist der Wachskreislauf. Sie kaufen kein Wachs hinzu. «Da weiss man nie, was alles enthalten ist», sagt Stauber. Sie reinigen das Bienenwachs und machen daraus wieder neue Mittelwände. Im Wohnzimmer steht dafür eine Art überdimensioniertes Bretzeleisen. «Damit giessen wir die Wände.»
Im Jahr produzieren Stauber und Bärtschi etwa 500 Gläser à 250 Gramm. Was sie nicht selber auf ihre eigenen Brötchen streichen, verkaufen sie – entweder direkt ab Bienenhaus oder über ihren Online-Shop. «Übers Jahr gesehen wende ich durchschnittlich einen halben Tag pro Woche für mein Hobby auf», sagt Stauber. «Bei den Bienen verbringe ich vielleicht zehn Prozent der Zeit.» Neben Zeit hat er auch eine Stange Geld investiert. «Rund 25 000 Franken werden es schon sein.» Darin eingerechnet ist das Bienenhaus, das ihm im Gegensatz zum Land, auf dem es steht, auch tatsächlich gehört, und die Bienenvölker, die er von seiner Vorgängerin übernommen hat. Die Nutzung ist übrigens zweckgebunden, es ist also zwingend Bienenland. Die Stadt redet auch sonst ein Wörtchen mit. Sie besteht darauf, dass er die sogenannte gute imkerliche Praxis einhält. Dafür muss er in die Schule: Den zweijährigen Grundkurs der Zürcher Bienenfreunde schliesst er im Herbst ab. Von ihnen bezieht er auch ab und zu eine neue Königin.
Und noch etwas Unerwartetes verrät der Jung-Imker der Reporterin. Nicht etwa auf dem Land sei die Qualität des Honigs am besten, sondern in der Stadt. «Wir haben hier das Glück, dass wir das Gute der Stadt und das Gute der ländlichen Umgebung vorfinden. Dank dem Biobauernhof in der Nähe und den Familiengärten, die ebenfalls Biovorschriften befolgen müssen, haben wir keinerlei Probleme mit Pestiziden.»
Stefan Stauber und Esther Bärtschi sind denn auch nicht die Einzigen, die in der Stadt Zürich Honigbienen halten (siehe dazu Box Stadthonig). Erklären lässt sich das leicht: Den Bienen geht es in der Stadt besser. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Biodiversität in der Stadt ist deutlich grösser als auf dem Land, und auch die leicht höheren Temperaturen tragen ihren Teil dazu bei.
Bienen in der noch nicht verdeckelten, frischen Wabe.